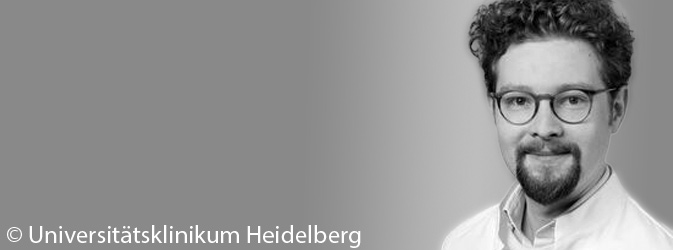Das MM ist eine klonale Plasmazellerkrankung, die durch eine komplexe Pathophysiologie und eine hohe interindividuelle Variabilität gekennzeichnet ist. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die Therapie von einer chemotherapeutisch dominierten Behandlung hin zu gezielten molekularen und immunologischen Therapieansätzen entwickelt. Diese Innovationen haben nicht nur die Prognose der Patienten verbessert, sondern auch die therapeutischen Ziele erweitert – von der Krankheitskontrolle hin zur potenziellen Heilung in Einzelfällen.
Die Behandlungsindikation beim MM orientiert sich an den sogenannten SliM-CRAB-Kriterien, die Endorganschäden, den Grad der Plasmazellinfiltration im Knochenmark sowie serologische Kriterien umfassen. Die Erfüllung eines SLiM-CRAB-Kriteriums ist als Behandlungsindikation ausreichend [1].
Die Auswahl der initialen Behandlung des MM erfordert eine sorgfältige Abwägung von Therapiezielen, substanzspezifischen Nebenwirkungsprofilen und der individuellen Krankheitsbiologie. Die Ziele für jedwede therapeutische Maßnahme sind eine schnelle und effektive Krankheitskontrolle und die Rückbildung krankheitsassoziierter Komplikationen.
Bei jüngeren oder fitten Patienten wird eine tiefe Remission im Sinne einer nicht mehr messbaren minimalen Resterkrankung (MRD) angestrebt. Ältere oder gebrechliche Patienten sollten hingegen eine weniger intensive, kontinuierliche Behandlung erhalten, um die Krankheit zu kontrollieren und gleichzeitig Nebenwirkungen zu minimieren.
In der Regel wird den Patienten das längste therapiefreie Intervall durch die Erstlinientherapie ermöglicht, weshalb die Dauer der ersten Remission einer der wichtigsten Faktoren für die Prognose der Erkrankung ist.
Bei der Auswahl der Erstlinientherapie sollte zunächst die erreichbare Dosisintensität eingeschätzt und somit zwischen einer Behandlung unter Einbeziehung einer Hochdosischemotherapie (HDT) gefolgt von autologer Blutstammzelltransplantation (ASCT) oder einer alleinigen medikamentösen Therapie unterschieden werden.
Aktuelle Standards der Erstlinientherapie
Transplantable Patienten
Die Behandlungssequenz bei jüngeren oder fitten Patienten umfasst eine Induktions- und Konsolidierungsphase inklusive HDT mit Melphalan und ASCT, gefolgt von einer Erhaltungstherapie. Bis vor einigen Jahren stellte eine Dreifachkombination aus verschiedenen Substanzklassen den Behandlungsstandard in der Induktions- und gegebenenfalls Konsolidierungsphase dar:
Proteasom-Inhibitoren (insbesondere Bortezomib [V]),
immunomodulatorische Substanzen (Thalidomid [T] oder Lenalidomid [R]),
Alkylanzien (Cyclophosphamid [C]),
einen gegen CD38 gerichteten monoklonalen Antikörper (Daratumumab [Dara] oder Isatuximab [Isa]) sowie
Glukokortikoide (Dexamethason [D]).
Die Ergebnisse einiger rezenter randomisierter Phase-III-Studien haben zur Zulassung von Vierfachkombinationen mit einem CD38-gerichteten Antikörper (Dara-VRd bzw. Isa-VRd) geführt und den bisherigen Standard abgelöst. Im Folgenden werden wir wegweisende Studien kurz näher betrachten. Einen Überblick über aktuelle Empfehlungen sowie Wirksamkeitsdaten aktueller Studien in der Erstlinie geben Abb. 1 und Tab. 1.