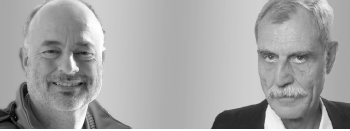„Transplantationsantigene“ oder beim Menschen auch HLA (human leukocyte antigens) genannt, sind nicht nur speziesspezifisch, sondern unterscheiden sich in ihrer Struktur auch von einem Individuum zum anderen. Speziesübergreifend werden die entsprechenden Gene auch als MHC (für major histocompatibility complex) abgekürzt. Beim Schwein heißen sie SLA (swine leukocyte antigens) [1].
Warum sind diese SLA für uns Menschen wichtig? Wer die medizinischen Schlagzeilen verfolgt hat, wird gelesen haben, dass dieses Jahr erstmals erfolgreich ein Herz von einem Schwein einem Menschen transplantiert wurde. „Erfolgreich“ heißt erst einmal nur, dass es zu schlagen anfing und nicht sofort abgestoßen wurde. Am 7. Januar 2022 erhielt ein 57-jähriger Amerikaner als erster Mensch das Herz eines Schweins. Er verstarb nach zwei Monaten. Zum Vergleich überlebte der Mensch, der als erstes erfolgreich am 3. Dezember 1967 ein menschliches Herz transplantiert bekam, lediglich 18 Tage.
Genetisch manipulierte Schweine
Das Herz stammte von keinem gewöhnlichen Schwein: In dem Spenderschwein hatte man drei Gene ausgeschaltet („Knock-out“), die für eine schnelle Abstoßung von Schweineorganen durch den menschlichen Körper verantwortlich sind, sowie zusätzlich ein viertes Gen, um das Wachstum des Schweineherzens einzudämmen. In diesem Zusammenhang sind bereits einige Veröffentlichungen zur Manipulation von SLA-Genen erschienen, darunter Versuche zur Ausschaltung oder Unterexpression von SLA der Klasse I. Des Weiteren wurden sechs menschliche Gene in das Erbgut eingefügt („Knock-in“), um die Akzeptanz des Schweineorgans zu verbessern [2].
Transplantationen bieten Schwerstkranken seit Jahrzehnten die Chance, unter Immunsuppression ein weitgehend normales Leben zu führen. Wenn man so will, ist auch eine Bluttransfusion eine Transplantation, doch während die Versorgung mit rund 15.000 Blutkonserven pro Tag in Deutschland gut funktioniert, gibt es einen erheblichen Mangel an Spenderorganen. Knapp 10.000 Deutsche warten derzeit auf eine Organtransplantation; in den USA sind es mehr als 100.000.
HLA und Transplantation
Stammen Blut, Knochenmark, Stammzellen oder solide Organe von einem anderen Menschen, so spricht man von einer Allotransplantation (griech. allos = ein anderer). Die Herztransplantation zwischen zwei Spezies, also z. B. Schwein/Mensch, bezeichnet man dagegen als Xenotransplantation (griech. xenos = fremd). Stammzellen können z. B. auch von Leukämiepatient:innen isoliert und nach einer Chemotherapie wieder reinfundiert werden. Dann spricht man von einer Autotransplantation (griech. auto = selbst).
Beim Menschen gibt es zwei große Gruppen von HLA/MHC-Molekülen: Die MHC-Klasse I findet sich auf allen kernhaltigen Zellen und wird in HLA A, B und C untergliedert. Die MHC-Klasse II ist überwiegend auf Antigen-präsentierenden Zellen wie B-Lymphozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen vertreten und umfasst die Unterklassen HLA DP, DQ und DR. Die enorme Zahl der verschiedenen Allele von aktuell über 24.000 Klasse-I- und fast 9.000 Klasse-II-Allelen, die – zumindest theoretisch – beliebig kombiniert werden können, lässt erahnen, dass man für die Auswahl eines geeigneten Organspenders niemanden mit identischen Allelen findet: Auch immunologisch ist also jeder Mensch (mit Ausnahme eineiiger Zwillinge) ein unverwechselbares Individuum.
Bei der Allotransplantation versucht man durch eine ausführliche Labordiagnostik beim Spender und Empfänger möglichst ähnliche HLA-Muster zusammenzuführen. Bei der Xenotransplantation kann man dagegen durch Knock-out-Mutationen die relevanten Antigenstrukturen des SLA-Systems direkt manipulieren.
HLA und Infektion
Natürlich haben die HLA-Allele nicht die Bestimmung, die Transplantation zu erschweren. Die gigantische Vielfalt individueller Muster ist vielmehr physiologisch wichtig, um gegen alle nur denkbaren Infektionserreger eine zelluläre Immunantwort initiieren zu können – und das nicht nur gegen die, die unser Immunsystem bereits kennt, sondern auch gegen solche, die noch auf uns zukommen könnten. Hier kommen die bereits erwähnten Antigen-präsentierenden Zellen ins Spiel, denn Proteine von Viren, Bakterien, Pilzen, Parasiten usw. werden in spezialisierten Immunzellen prozessiert und den T-Zellen über HLA-Moleküle auf der Oberfläche als Kennzeichen von eingedrungenem körperfremden Material angeboten.
Damit ist auch verständlich, dass unterschiedliche HLA-Moleküle zu teils ungünstigen und teils günstigen Immunantworten führen können (Tab. 1).