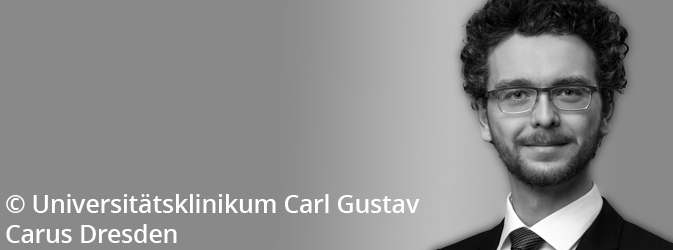Die durchschnittliche jährliche Inzidenz für TETs liegt laut Berichten aus den Niederlanden bei 3,4 pro eine Million Einwohner; geschlechtsspezifische Unterschiede werden nicht berichtet. Daten aus Deutschland sind nicht verfügbar [1], jedoch werden die Inzidenz und Prävalenz thymischer Tumoren hier ähnlich hoch wie in den Niederlanden eingeschätzt. Bei aktuell etwa 80 zertifizierten Lungenkrebszentren und etwa 84 Millionen Einwohnern in Deutschland kann also im Jahr je Zentrum circa mit drei bis fünf neuen Patienten mit einem thymischen Tumor gerechnet werden.
Klassifizierung der Thymome und Thymuskarzinome
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet eine Klassifizierung für THs, die fünf Hauptkategorien umfasst: A, AB, B1, B2 und B3. Dieses System basiert auf der Morphologie der neoplastischen Epithelzellen und dem Anteil an unreifen Lymphozyten.
TCs werden in Plattenepithelkarzinome, Adenokarzinome, adenosquamöse Karzinome und Karzinome ohne anderweitige Differenzierung (NOS) eingeteilt [2, 3].